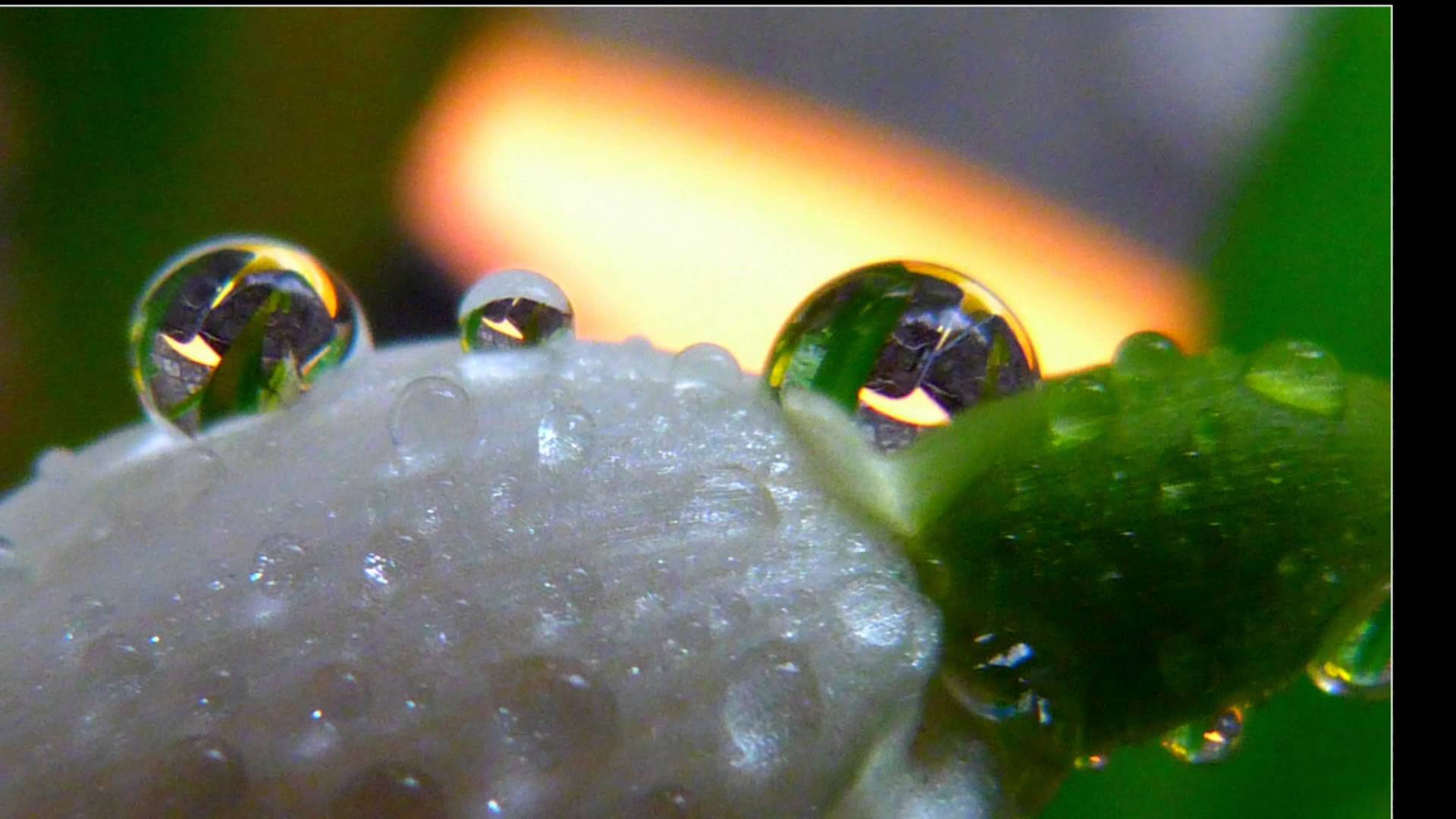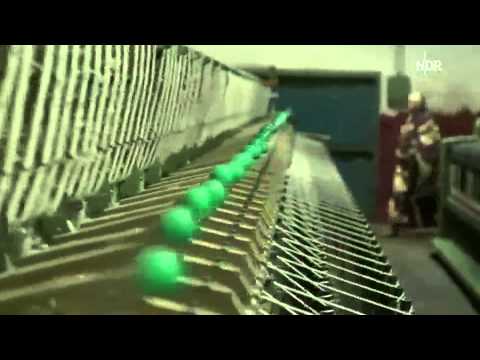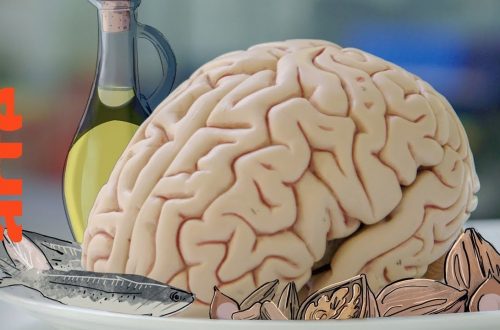-
Tropfenuniversum…
-
Fleischlos glücklich: Mediterranes Spaghetti-Tomaten-Gericht, perfekt für heiße Tage
-
Tomatenzeit ist die Zeit des Schwelgens ….
 …diese Tomaten sind allerdings keine Supermarkttomaten, es sind heimische sozusagen ” Bremer UmzuTomaten ” aus Stuhr und sie sind so unvergleichlich aromatisch, sind so schmackhaft, daß man wenn man mal begonnen hat zu futtern, gar nicht mehr aufhören möchte! Erwerben kann man sie auf dem Bremer Findorffmarkt am Stand der Familie True. Zwischen neun bis zehn Sorten kann man auswählen oder so wie wir von jeder Sorte ein paar.
…diese Tomaten sind allerdings keine Supermarkttomaten, es sind heimische sozusagen ” Bremer UmzuTomaten ” aus Stuhr und sie sind so unvergleichlich aromatisch, sind so schmackhaft, daß man wenn man mal begonnen hat zu futtern, gar nicht mehr aufhören möchte! Erwerben kann man sie auf dem Bremer Findorffmarkt am Stand der Familie True. Zwischen neun bis zehn Sorten kann man auswählen oder so wie wir von jeder Sorte ein paar.
Manche erinnern in ihrem Aroma nicht so sehr an Tomaten, eher an süßes Obst.
Natürlich haben diese Meisterstücke aus ökologischem Abau ihren Preis aber das ist wohl klar, denn Tomatenzeit, echte Tomatenzeit ist auch nur einmal im Jahr! -
Wo kommen all die toten Hummeln her?
Mitten im Hochsommer Massensterben unter blühenden Linden
Alljährlich im Hochsommer kommt es unter Linden zu Massensterben von Hummeln. Hier ist jedoch kein Gift im Spiel, die Hummeln verhungern schlichtweg. Wir erläutern die Mechanismen des Hummelsterbens und geben Tipps für hummelfreundliche Gärten.

Tote Hummeln – Foto: NABU/Peter Hildebrandt Wissenschaftler, Naturschützer und die besorgte Öffentlichkeit standen lange vor einem Rätsel. Manche Autoren bezweifelten gar, dass es überhaupt ein spezielles Hummelsterben unter Linden gebe, dieses sei vielmehr eine Art optische Täuschung. Die Tiere würden genauso häufig in Wiesen oder Äckern sterben, fielen dort aber nicht ins Auge. Nachsuchungen und Zählungen widerlegten diese Annahme schnell.
Natürliches Sterben der Hummelvölker?
Die nächste Hypothese besagte, dass die Blütezeit der Silberlinde mit der natürlichen Absterbephase von Hummelvölkern zusammenfalle. Die Hummeln stürben also sozusagen an Altersschwäche oder würden bereits stark geschwächt zur leichten Beute von Fressfeinden. Tatsächlich nutzen Kohlmeisen und Fliegenschnäpper, aber auch bestimmte Falten- und Grabwespen die Ansammlungen sterbender und toter Hummeln als bequeme Beute. Bei mehrjährigen Untersuchungen der Universität Münster in den 1990er Jahren wiesen drei Viertel der knapp 11.000 analysierten Hummeln Fraßspuren auf. Gleichzeitig stellten die Forscher unter Leitung von Professor Bernhard Surholt jedoch fest, dass die gestorbenen Tiere keineswegs überaltert, sondern meist im besten Hummelalter waren.Nektarmangel in Gärten und Grünanlagen
Hauptgrund für das Hummelsterben ist also der Nektarmangel im Hochsommer, ausgelöst durch immer steriler werdende Gärten und Grünanlagen und die weitere Ausräumung der freien Landschaft. Linden stellen die letzten großen Nektarquellen in der Vegetationsperiode dar. Dies gilt vor allem für die Stadt, wo diese Bäume durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Versiegelung und Luftverschmutzung eine wichtige Rolle spielen. Während das Nahrungsangebot im Juni noch äußerst üppig ist und die Insektenvölker stark wachsen, wird Ende Juli die Nahrung knapp. Obwohl die Sommerlinde sehr viel Zucker anbietet, kann sie alleine den Hunger der Insekten nicht mehr stillen.Der Nahrungsmangel betrifft freilich alle Blütenbesucher. Dass vor allem Hummeln vom Massensterben betroffen sind, liegt an deren Sammelstrategie: Hummeln legen anders als Honigbienen kaum Vorräte an. Außerdem gewöhnen sie sich nur sehr langsam an neue Pflanzen. Die Untersuchungen zum Hummelsterben führen so zu einer sehr allgemeinen Forderung zurück: Zum Überleben unserer Tierwelt brauchen wir möglichst viele ungenutzte oder schonenden bewirtschaftete Flächen, auf denen sich einen vielfältige Pflanzenwelt ansiedeln kann – nicht nur der Hummeln wegen.
Nur eine Verbesserung des Nahrungsangebotes bringt hier langfristig eine Lösung: Blühende Wildpflanzen, die meist als Unkraut abgetan werden, könnten die Versorgungslücken stopfen. Die Nahrungsknappheit werde durch das notorische Abmähen von Wiesen und Gärten zusätzlich verstärkt, das Wildkräuter am Samenwurf hindern soll. Statt farbenprächtige, aber nektararme Hybriden zu pflanzen, sollten nektarreiche, wilde Blütenpflanzen wieder in unseren Gärten und Parks Einzug erhalten.
Helge May
Nektar- und pollenreiche Gartenpflanzen
Vor allem spät blühende Stauden könnten das Massensterben von Hummeln im Juli und August eindämmen. Hier eine kleine Liste von geeigneten Spät- und Dauerblühern:
►Die Artischocke (Cynaria scolymus) kennen die meisten Mitmenschen nur vom Gemüsestand. Ihre großen, attraktiv blau-violetten Blüten sind eine reiche Nahrungsquelle für Hummeln und Bienen aller Art. Die Art ist zweijährig, im ersten Jahr erscheint also nur eine Blattrosette und im zweiten Jahr wächst sie dann auf rund zwei Meter Höhe an.
►Die blau blühende, bis einen Meter hohe Bartblume (Caryopteris spec.) lässt sich gut als Kübelpflanze verwenden. Nach der Überwinterung an einem schattigen Ort bis fünf bis zehn Grad plus wird sie im Frühjahr um ein Drittel zurückgeschnitten.
►Büschelschön (Phacelia tanacetifolia) gibt es mancherorts gleich ackerweise. Die auch Phacelie genannte Pflanze wird nämlich zur Gründüngung angebaut. Im Garten ist sie anspruchslos und kann wie in der Landwirtschaft auch als Gründüngung auf Nutzpflanzenbeeten verwendet werden.
►Efeu (Hedera helix) bietet zu einem besonders späten Zeitpunkt Ende September/Anfang Oktober reichlich Nektar für Insekten aller Art – also bitte nicht schon im Sommer beschneiden! Vor allem Falter und Schwebfliegen stellen sich in großer Zahl ein. Die heimische Kletterpflanze gedeiht gut an schattigen Mauern, hat aber auch gegen ein sonnigen Standort nur wenig einzuwenden. Die kugeligen Blütenstände erscheinen erst ab einem Alter von acht bis zehn Jahren.
►Heidekraut (Calluna vulgaris) benötigt mageren und vor allem sauren Boden. Die niedrigen Halbsträucher blühen bis in den September hinein. Sie sollten einmal im Jahr geschnitten werden, das fördert die Blühfähigkeit.
►Sämtliche Klee-Arten (Trifolium spec.) sind gute Trachtpflanzen. Sie können in die Gartenwiese eingesät werden und benötigen keinen Stickstoffdünger, da sie diesen zusammen mit Knöllchenbakterien aus der Bodenluft selbst gewinnen.
►Die attraktive Kugeldistel (Echinops spec.) ist eine je nach Art bis anderthalb Meter hohe, zweijährige Pflanze (siehe Artischocke) aus südlichen und östlichen Gefilden. Sie wird ständig von Hummeln, Wespen und Bienen belagert, weshalb Imker sie gerne um ihre Bienenstöcke herum anpflanzen.
►Lavendel (Lavandula spec.) ist eine Duftpflanze, die jeden Garten bereichert. Lavendel hat es gerne warm und trocken. Bestäuberinsekten zieht er an, Ameisen und Läuse dagegen vertreibt er, weshalb er sich gut eignet, um zusammen mit Rosen im Beet zu stehen.
►Malven (Malva spec.) und Stockrosen (Alcaea spec.) werden auch mit gefüllten Blüten angeboten, aber das hilft den Hummeln natürlich nicht. Also beim Kauf unbedingt auf ungefüllte Sorten achten. Die Farbpracht bleibt ungeschmälert.
►Der Natternkopf (Echium vulgare) ist eine heimische Wildstaude und gedeiht auf trocken-warmen Böden. Neben Hummeln und Schmetterlingen lockt der Langblüher (etwa von Mai bis August) auch unzählige Wildbienenarten an.
►Der Sommerflieder (Buddleia davidii) firmiert verbreitet unter der Bezeichnung Schmetterlingsflieder, was ein deutlicher Hinweis auf seine Beliebtheit bei Insekten ist. Den Strauch mit seinen leicht überhängenden Zweigen gibt es in violett und weiß. Wie man es auch von Flieder kennt, sorgt ein spätherbstlicher Rückschnitt für vermehrtes Blühen im Folgejahr.
►Die diversen Sonnenhut-Arten (Rudbeckia und Echinacaea) bilden dichte Stauden, aus denen je nach Sorte Blütenstängel von einem halben bis zwei Metern Höhe sprießen. Sonnenhüte sind klassische Bauerngartenpflanzen.
►Die heimische Taubnessel (Lamium spec.) gibt es in weiß oder in purpur. Im Halbschatten unter Büschen und Bäumen sollte sie auch im naturnahen Garten einen Platz finden. Teils blühen die Pflanzen bis in den Winter hinein.
Link zum NABU-Artikel: http://bit.ly/1J0S9Kg
-
Es gibt sie noch, die herrlichen alten Solitärbäume…
-
Kamillenbesucher…
-
Als Tierquälerei kann es bezeichnet werden, wenn alte Kühe noch Kälber zur Welt bringen müssen und unter der Last ihrer zu großen Euter fast zusammenbrechen…
-
Der Schweizer Soziologe Jean Ziegler, 80, ist einer der weltweit profiliertesten Kritiker der Globalisierung und der Finanzmärkte. Von 2000 bis 2008 war er UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. In seinem neuesten Buch „Ändere die Welt – Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen“ kritisiert er drastisch und plakativ die Folgen „der globalen Diktatur der Finanzoligarchie“. Die Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel, die unkontrollierte Macht der Großkonzerne sowie die immer größere Ungleichheit der weltweiten Vermögensverteilung sieht er als Folge der „neoliberalen Wahnidee“. Ziegler hofft auf den Zusammenschluss einer neuen Zivilgesellschaft, die von den Textilarbeitern in Bangladesh über Kleinbauern in Afrika bis zu Attac in den westlichen Finanzmetropolen reicht.
WirtschaftsBlatt: Der Untertitel ihres neuesten Buches heißt “Warum wir die kannibalische Weltordnung stürzen müssen”. Was ist kannibalisch an der Welt?
Jean Ziegler: Erstens: Die totale Ungleichheit. Laut OXFAM-Bericht besitzen ein Prozent der Weltbevölkerung so viele Vermögenswerte wie die restlichen 99 Prozent zusammen. Zweitens: In den 122 sogenannten Entwicklungsländern stirbt alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger, das ist ein tägliches Massaker. Obwohl der World Food Report der UN bestätigt, dass die Landwirtschaft heute zwölf Milliarden Menschen ernähren könnte, also deutlich mehr als die aktuelle Weltbevölkerung. Das sind die Folgen der globalisierten Diktatur des Finanzkapitals, unter der wir leben. Das ist die kannibalische Weltordnung, die ich angreife.
Ich besitze auch Aktien. Bin ich deshalb ein Kannibale
Ziegler: Wenn Sie ihr erspartes Geld der Wirtschaft für Investitionen zur Verfügung stellen, ist das sinnvoll. Aber es kommt natürlich auf das Unternehmen an: Es muss Teil der Realwirtschaft sein und etwas sinnvolles produzieren, also keine Waffen. Und wenn Sie viele Aktien besitzen und hohe Dividenden kassieren, ohne zu arbeiten, dann kommen Sie in die Gefahrenzone.
Sind an jedem Kind, das in Afrika verhungert, die großen Konzerne schuld?
Ziegler: Die 500 größten Konzerne kontrollieren 52,8 Prozent des weltweiten Bruttosozialproduktes. Die haben mehr Macht als ein Kaiser oder Papst je hatte, das ist historisch einmalig.
Also sind diese Unternehmen schuld am Hunger in der Welt?
Ziegler: Ganz so simpel ist es nicht, es geht um die dahinter stehenden Strukturen. Diese Konzerne funktionieren nach nur einem Prinzip: Der Profitmaximierung, völlig ohne soziale oder politische Kontrolle. Dahinter steckt ein System der strukturellen Gewalt. Ich kenne Nestle-Chef Peter Brabeck-Letmathe, das ist ein hochanständiger Mann. Aber wenn er den Shareholder Value nicht jedes Jahr um 15 oder 20 Prozent hinaufjagt, ist er schnell weg. Das gilt für alle anderen Top-Manager auch. Deshalb gibt es Börsenspekulation auf Grundnahrungsmittel, was deren Preise in die Höhe treibt und Essen für viele Millionen Menschen unerschwinglich macht. Der Preis für eine Tonne Weizen hat sich in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Dort werden gigantische Profite gemacht, ganz legal. Auch das Agrar-Dumping der EU, das die Entsorgung von Überschüssen nach Afrika subventioniert, verschärft das Problem. Dadurch kann man in Dakar je nach Saison deutsches Gemüse um die Hälfte billiger kaufen als einheimische Produkte, verrückt.
Wäre es besser, diese Lebensmittel zu vernichten?
Ziegler: Franz Fischler war ein sehr guter Landwirtschaftskommissar, wahrscheinlich der beste, den es gegeben hat. Er hat die chemische Entsorgung der Überschüsse erfunden. Doch da hat es einen öffentlichen Aufschrei gegeben, woraufhin das Dumping wieder aktiviert wurde. Viele afrikanische Bauern rackern sich auf ihren Feldern ab und haben nicht die geringste Chance, auf ein Existenzminimum zu kommen. So produziert die EU Hunger in Afrika. Und wenn die Flüchtlinge dann nach Europa kommen, werden sie zurück ins Meer geworfen. Das ist absolut verlogen.
Hinzu kommt die totale Überschuldung der ärmsten Länder. Sie können kein Geld in die Landwirtschaft investieren, weil alles bei den Gläubigerbanken landet. Vergangenes Jahr sind in Schwarzafrika 41 Millionen Hektar Ackerland von Konzernen mit Unterstützung der Weltbank aufgekauft worden. Wenn dort sozial verantwortlich investiert werden würde, wäre das ja nicht schlimm. Tatsächlich werden die Bauern aber vertrieben und es werden Blumen und Lebensmittel angepflanzt, die dann nach Europa und in anderen Regionen mit hoher Kaufkraft exportiert werden. Das ist reinster Landraub.
Was können nationale Regierungen dagegen tun?
Ziegler: Es gibt keinen Mechanismus, keine Struktur, die nicht von Menschen gemacht worden ist – und deshalb auch von Menschen geändert werden kann. Es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie, diese wird uns nur eingeredet. Es gehört zur neoliberalen Wahnidee, dass das Wirken der Marktkräfte ein Naturgesetz ist, das man nicht ändern kann. Aber das ist falsch, das ist Ideologie. Wenn der österreichische Finanzminister im Juni zur Weltwährungskonferenz nach Washington fährt, hindert ihn nichts daran, einmal nicht für die großen Gläubigerbanken zu stimmen, sondern für die hungernden Kinder, also die Totalentschuldung der ärmsten Länder. Die Börsenspekulation mit Grundnahrungsmittel kann morgen früh per Gesetz verboten werden, wenn wir das wollen.
Ist es wirklich so einfach? Nicht die Politik schafft Arbeitsplätze, sondern die Unternehmen. Dadurch haben sie automatisch eine gewisse Macht, die sich per Parlamentsbeschluss nicht abschaffen lässt.
Ziegler: Die Unternehmen erbringen enorme Leistungen hinsichtlich technologischer Entwicklungen, es gibt dort unglaubliches Wissen, das bestreite ich nicht. Aber das darf nicht ohne Kontrolle geschehen. Die Bilanzsumme der UBS ist drei Mal so groß wie das Nationalprodukt der Schweiz – das ist lebensgefährlich für das Land.
Was kann eine Regierung dagegen tun?
Ziegler: In Frankreich hat das Parlament beschlossen, dass Unternehmen keine Mitarbeiter kündigen dürfen, wenn der Betrieb Gewinn macht. Das ist eine sinnvolle Maßnahme gegen die Arbeitslosigkeit. In Griechenland ist es richtig, dass sich die Regierung wehrt. Mit dieser Verschuldung ist das Land in zwei Monaten zerstört, wenn es keinen Schuldenschnitt gibt.
Der deutsche Finanzminister Schäuble würde dazu sagen: Wenn jemand 1.000 Euro im Monat verdient und regelmäßig 2.000 ausgibt, wird man sein Problem nicht lösen, indem man ihm einmalig die Schulden erlässt. Hat er Unrecht?
Ziegler: Frühere Regierungen haben sich durch das gewaltige Ausmaß an Korruption und der tolerierten Steuerflucht schuldig gemacht gegenüber dem griechischen Volk, das ist absolut wahr. Aber die Zustände sind dort wirklich dramatisch, die Menschen in Athen suchen in Abfalleimern nach Nahrung, es herrscht echtes Elend. Und denen jetzt zu sagen, ihr müsst noch mehr sparen, damit ihr der Deutschen Bank Zinsen zahlen könnt, das ist zutiefst unmenschlich und bringt das Land um. Denn diese Banken sind ja mitschuldig an der Situation. Die Banken haben großzügig Kredite vergeben, obwohl sie wussten, dass die das Geld nicht zurückzahlen können. Das ist eine Illegitime Schuld.
Ihr Buch ist sehr pessimistisch….
Ziegler: Nein, überhaupt nicht. Es entsteht gerade ein ganz neues Phänomen, die planetarische Zivilgesellschaft, die sich gegen die Ungerechtigkeiten und die Diktatur des Finanzkapitals wehrt. Beim Weltsozialforum in Tunis kommen jetzt Vertreter von 8.000 Nicht-Regierungsorganisationen zusammen. Das sind neue soziale Bewegungen, die gehorchen keiner Partei. Von Attac bis zu Initiativen von Kleinbauern, da tut sich wirklich unglaublich viel.
Der nächste große Konflikt heißt TTIP. Wie wird das ausgehen?
Ziegler: Das ist das Armageddon, der Endkampf. Ich hoffe, dass TTIP nicht kommt. Der Freihandel bringt viel weniger Wachstum als gedacht. Er bedeutet aber umgekehrt, dass vieles, was erkämpft wurde, von Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer bis zu Qualitätsstandards für Nahrungsmittel und Umweltauflagen, in Gefahr wäre. Wenn TTIP in dieser Form durchkommt, ist eine entscheidende Schlacht verloren.
-
Fleischlos glücklich: Wenn schon grillen, dann lieber vegetarisch …
 …das ist nicht nur gesünder, wir schonen unsere Tierwelt und der Geruch des Gegrillten ist für unsere Nachbarn nicht im mindesten so störend und penetrant wie bei Würstchen & Co!
…das ist nicht nur gesünder, wir schonen unsere Tierwelt und der Geruch des Gegrillten ist für unsere Nachbarn nicht im mindesten so störend und penetrant wie bei Würstchen & Co!
Es lassen sich nicht nur Kartoffeln grillen, sondern so ziemlich alle Gemüsesorten wie Möhren, Paprikaschoten, Tomaten, Fenchel, Zuchini, Aubergine ect. und last but not least leckere vegetarische Hamburger! ( Couscousfrikadellen) Nicht zu vergessen Tofu in allen Varianten und Geschmacksrichtungen! Dazu einen knackigen grünen oder bunten Salat und fertig ist die Laube… -
Zusammenhang von Fleischkonsum und Welthunger
 Das Umweltbundesamt (UBA) rät zu einer Reduzierung des Fleischkonsums innerhalb der Industrieländer, um die Welthungerproblematik zu entschärfen. Dies ist eine der Kernaussagen eines im Oktober erschienenen Positionspapiers des UBA zur nachhaltigen Land- und Biomassenutzung. Hauptanliegen des Positionspapiers »Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen« ist die Anregung eines umweltverträglichen und sozial gerechteren Umgangs mit globalen Ressourcen unter besonderer Berücksichtigung der weltweiten Ernährungssicherheit.
Das Umweltbundesamt (UBA) rät zu einer Reduzierung des Fleischkonsums innerhalb der Industrieländer, um die Welthungerproblematik zu entschärfen. Dies ist eine der Kernaussagen eines im Oktober erschienenen Positionspapiers des UBA zur nachhaltigen Land- und Biomassenutzung. Hauptanliegen des Positionspapiers »Globale Landflächen und Biomasse nachhaltig und ressourcenschonend nutzen« ist die Anregung eines umweltverträglichen und sozial gerechteren Umgangs mit globalen Ressourcen unter besonderer Berücksichtigung der weltweiten Ernährungssicherheit.Derzeit leiden laut der Welternährungsorganisation FAO etwa 870 Millionen Menschen an Hunger und Unterernährung (FAO 2012), was – so das Positionspapier des UBA – zum einen auf Armut und die ungerechte Verteilung verfügbarer Nahrungsmittel zurückzuführen ist, zum anderen am ressourcenverschwenderischen Konsum der Industrie- und Schwellenländer liegt. Die zur Produktion von Landwirtschaftserzeugnissen notwendigen Ressourcen wie Land und Wasser sind bereits heute knapp bemessen. Deutlich zuspitzen wird sich die Situation zukünftig durch das Weltbevölkerungswachstum auf voraussichtlich über 9 Milliarden Menschen bis zum Jahr 2050. Um alle diese Menschen mit ausreichend Nahrung versorgen zu können, müssten dann laut FAO 70% mehr Nahrungsmittel als derzeit produziert werden. Da eine solche Steigerung nur schwer realisierbar ist, ohne gravierende Umweltschäden hervorzurufen, ist es laut UBA für die Industrieländer dringend geboten, Änderungen im Konsumverhalten vorzunehmen.
Fleischkonsum gefährdet die Ernährungssicherheit
In den Mittelpunkt der Betrachtung rückt das Umweltbundesamt in diesem Zusammenhang den Fleischkonsum. Nach Angaben des Positionspapiers ist der Fleischverbrauch pro Kopf in den Industrieländern mit durchschnittlich 82 kg pro Jahr erheblich höher als in den Entwicklungsländern (31 kg pro Jahr). Seit 1970 hat sich der weltweite Fleischkonsum verdreifacht – eine Umkehr des Trends ist (zumindest global gesehen) noch nicht in Sicht.
Nach Ansicht des UBA ist dies vor allem deshalb problematisch, weil die Produktion von Fleisch in direkter Konkurrenz zur globalen Ernährungssicherung steht. In Massentierhaltung gehaltene »Nutztiere« werden zu einem hohem Anteil mit Nahrung gefüttert, die ebenso gut für den menschlichen Verzehr geeignet wäre (v.a. Mais, Soja und Getreide). Diese Nahrung wird somit im Hinblick auf die Hungerproblematik regelrecht verschwendet, denn die Tiere wandeln nur einen Bruchteil der ihnen zugeführten Nährstoffe in Fleisch um. 34% des weltweit produzierten Getreides wurden im Jahr 2011 als Nutztierfutter und lediglich 46% direkt zur menschlichen Ernährung verwendet – die restlichen 20% wurden zu Treibstoff oder anderen Industrieprodukten verarbeitet.
Ressourcenverschwendung durch Fleischproduktion
Laut Angaben des Positionspapiers beansprucht die Produktion von tierischen Lebensmitteln im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln deutlich mehr Ressourcen und geht mit höheren Umweltbelastungen einher. Der in den Industrieländern bestehende Ressourcenbedarf für die Tierproduktion geht auf Kosten der weniger entwickelten Länder. So kann etwa der Tierfutterbedarf der Industrieländer nur dadurch gedeckt werden, dass der Futteranbau auf Landflächen in Entwicklungsländern ausgeweitet wird. Laut einer aktuellen Studie von »Brot für die Welt« hat dies für die betroffenen Länder weitreichende Folgen, wie die Regenwaldzerstörung und die Verdrängung von Kleinbauern und indigenen Völkern.
Dem UBA-Positionspaper zufolge beansprucht die EU allein für ihre Sojaimporte13 Mio. ha Ackerflächen in Südamerika – dies entspricht mehr als einem Drittel der Gesamtfläche Deutschlands. Eine Reduzierung des Fleischverbrauchs der Industrieländer würde nach Einschätzung des Umweltbundesamtes (neben positiven Effekten auf Umwelt und Gesundheit) enorme Ackerlandflächen freisetzen und somit potentiell zur Ernährungssicherung von Menschen in ärmeren Ländern beitragen.
Empfehlungen des Umweltbundesamtes
Als Ergebnis erteilt das UBA-Positionspapier konkrete Politikempfehlungen, welche die Verbraucher anregen sollen, ihre Ernährung vorrangig pflanzlich und fleischreduziert zu gestalten.
Empfohlen werden die Einführung einer Fettsteuer sowie der Abbau von Steuervergünstigungen für tierische Lebensmittel. Ersteres bedeutet einen Preisanstieg von Lebensmitteln mit gesättigten Fettsäuren proportional zu ihrem Fettgehalt (Butter und Schlagsahne würden demnach verhältnismäßig am teuersten, Fleisch würde sich ebenfalls verteuern). Letzteres meint die Erhebung des vollen Mehrwertsteuersatzes von 19% auf alle tierischen Lebensmittel – statt der bisher für fast alle Tierprodukte üblichen 7%.
Begleitet werden sollten diese steuerlichen Maßnahmen laut UBA durch die Einführung fleischreduzierter Speisepläne in öffentlichen Einrichtungen sowie durch Kampagnen und Bildungsmaßnahmen zur Förderung des nachhaltigen Konsumverhaltens, in denen verstärkt über den Zusammenhang des Fleischkonsums mit Umwelt-, Gesundheits- und Ressourcenproblemen aufgeklärt wird.
Fazit
Die Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt begrüßt es sehr, dass das Umweltbundesamt die aufgeführten Punkte zusammengetragen hat und dazu konkrete Forderungen aufstellt. Dies ist ein entscheidender Beitrag dazu, dass sich das Wissen über die Folgen der überhöhten Fleischproduktion in der Politik verbreitet und daraus Taten resultieren.