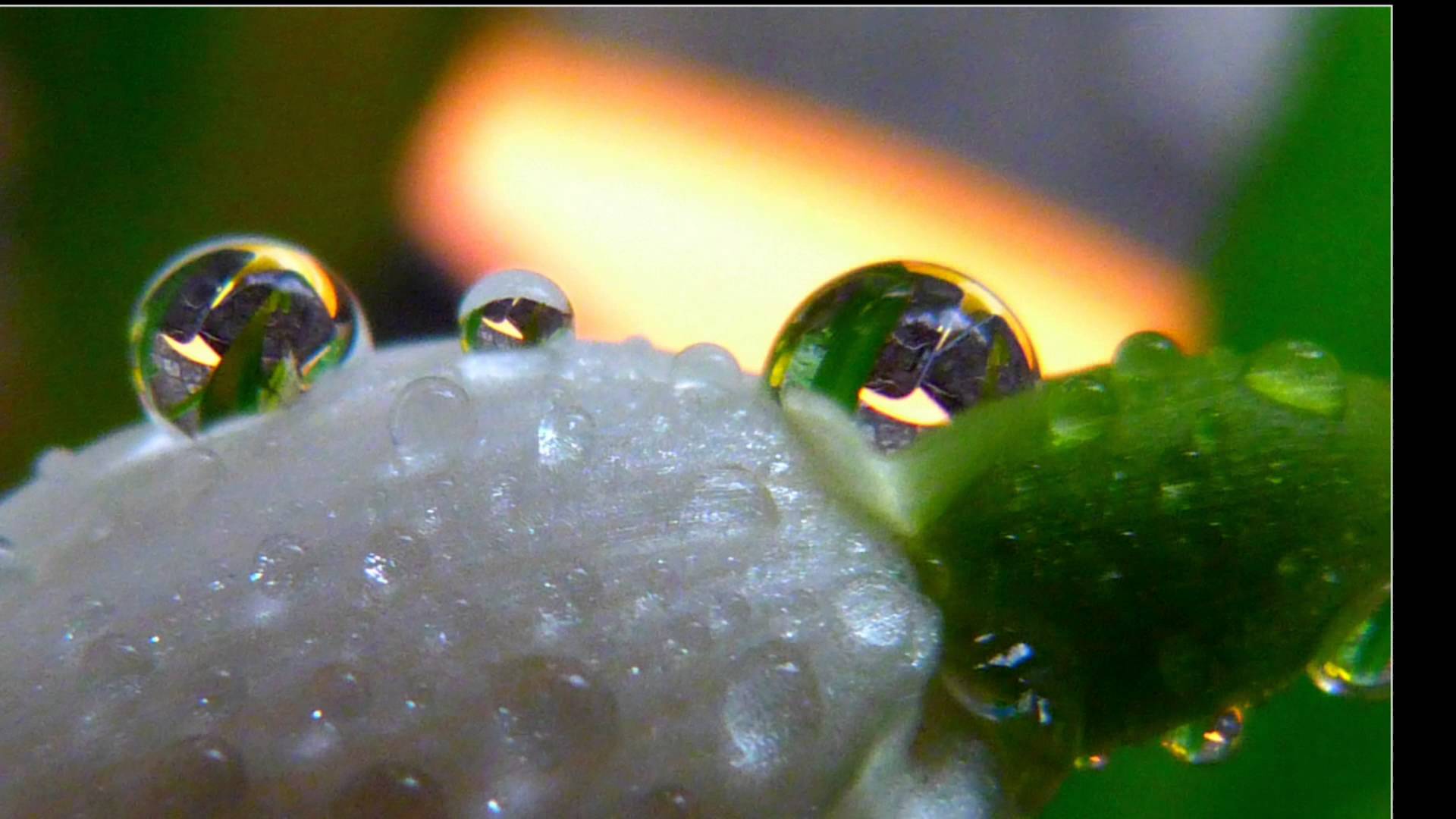Wo kommen all die toten Hummeln her?
Mitten im Hochsommer Massensterben unter blühenden Linden
Alljährlich im Hochsommer kommt es unter Linden zu Massensterben von Hummeln. Hier ist jedoch kein Gift im Spiel, die Hummeln verhungern schlichtweg. Wir erläutern die Mechanismen des Hummelsterbens und geben Tipps für hummelfreundliche Gärten.

Wissenschaftler, Naturschützer und die besorgte Öffentlichkeit standen lange vor einem Rätsel. Manche Autoren bezweifelten gar, dass es überhaupt ein spezielles Hummelsterben unter Linden gebe, dieses sei vielmehr eine Art optische Täuschung. Die Tiere würden genauso häufig in Wiesen oder Äckern sterben, fielen dort aber nicht ins Auge. Nachsuchungen und Zählungen widerlegten diese Annahme schnell.
Natürliches Sterben der Hummelvölker?
Die nächste Hypothese besagte, dass die Blütezeit der Silberlinde mit der natürlichen Absterbephase von Hummelvölkern zusammenfalle. Die Hummeln stürben also sozusagen an Altersschwäche oder würden bereits stark geschwächt zur leichten Beute von Fressfeinden. Tatsächlich nutzen Kohlmeisen und Fliegenschnäpper, aber auch bestimmte Falten- und Grabwespen die Ansammlungen sterbender und toter Hummeln als bequeme Beute. Bei mehrjährigen Untersuchungen der Universität Münster in den 1990er Jahren wiesen drei Viertel der knapp 11.000 analysierten Hummeln Fraßspuren auf. Gleichzeitig stellten die Forscher unter Leitung von Professor Bernhard Surholt jedoch fest, dass die gestorbenen Tiere keineswegs überaltert, sondern meist im besten Hummelalter waren.
Nektarmangel in Gärten und Grünanlagen
Hauptgrund für das Hummelsterben ist also der Nektarmangel im Hochsommer, ausgelöst durch immer steriler werdende Gärten und Grünanlagen und die weitere Ausräumung der freien Landschaft. Linden stellen die letzten großen Nektarquellen in der Vegetationsperiode dar. Dies gilt vor allem für die Stadt, wo diese Bäume durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Versiegelung und Luftverschmutzung eine wichtige Rolle spielen. Während das Nahrungsangebot im Juni noch äußerst üppig ist und die Insektenvölker stark wachsen, wird Ende Juli die Nahrung knapp. Obwohl die Sommerlinde sehr viel Zucker anbietet, kann sie alleine den Hunger der Insekten nicht mehr stillen.
Der Nahrungsmangel betrifft freilich alle Blütenbesucher. Dass vor allem Hummeln vom Massensterben betroffen sind, liegt an deren Sammelstrategie: Hummeln legen anders als Honigbienen kaum Vorräte an. Außerdem gewöhnen sie sich nur sehr langsam an neue Pflanzen. Die Untersuchungen zum Hummelsterben führen so zu einer sehr allgemeinen Forderung zurück: Zum Überleben unserer Tierwelt brauchen wir möglichst viele ungenutzte oder schonenden bewirtschaftete Flächen, auf denen sich einen vielfältige Pflanzenwelt ansiedeln kann – nicht nur der Hummeln wegen.
Nur eine Verbesserung des Nahrungsangebotes bringt hier langfristig eine Lösung: Blühende Wildpflanzen, die meist als Unkraut abgetan werden, könnten die Versorgungslücken stopfen. Die Nahrungsknappheit werde durch das notorische Abmähen von Wiesen und Gärten zusätzlich verstärkt, das Wildkräuter am Samenwurf hindern soll. Statt farbenprächtige, aber nektararme Hybriden zu pflanzen, sollten nektarreiche, wilde Blütenpflanzen wieder in unseren Gärten und Parks Einzug erhalten.
Helge May
Nektar- und pollenreiche Gartenpflanzen
Vor allem spät blühende Stauden könnten das Massensterben von Hummeln im Juli und August eindämmen. Hier eine kleine Liste von geeigneten Spät- und Dauerblühern:
►Die Artischocke (Cynaria scolymus) kennen die meisten Mitmenschen nur vom Gemüsestand. Ihre großen, attraktiv blau-violetten Blüten sind eine reiche Nahrungsquelle für Hummeln und Bienen aller Art. Die Art ist zweijährig, im ersten Jahr erscheint also nur eine Blattrosette und im zweiten Jahr wächst sie dann auf rund zwei Meter Höhe an.
►Die blau blühende, bis einen Meter hohe Bartblume (Caryopteris spec.) lässt sich gut als Kübelpflanze verwenden. Nach der Überwinterung an einem schattigen Ort bis fünf bis zehn Grad plus wird sie im Frühjahr um ein Drittel zurückgeschnitten.
►Büschelschön (Phacelia tanacetifolia) gibt es mancherorts gleich ackerweise. Die auch Phacelie genannte Pflanze wird nämlich zur Gründüngung angebaut. Im Garten ist sie anspruchslos und kann wie in der Landwirtschaft auch als Gründüngung auf Nutzpflanzenbeeten verwendet werden.
►Efeu (Hedera helix) bietet zu einem besonders späten Zeitpunkt Ende September/Anfang Oktober reichlich Nektar für Insekten aller Art – also bitte nicht schon im Sommer beschneiden! Vor allem Falter und Schwebfliegen stellen sich in großer Zahl ein. Die heimische Kletterpflanze gedeiht gut an schattigen Mauern, hat aber auch gegen ein sonnigen Standort nur wenig einzuwenden. Die kugeligen Blütenstände erscheinen erst ab einem Alter von acht bis zehn Jahren.
►Heidekraut (Calluna vulgaris) benötigt mageren und vor allem sauren Boden. Die niedrigen Halbsträucher blühen bis in den September hinein. Sie sollten einmal im Jahr geschnitten werden, das fördert die Blühfähigkeit.
►Sämtliche Klee-Arten (Trifolium spec.) sind gute Trachtpflanzen. Sie können in die Gartenwiese eingesät werden und benötigen keinen Stickstoffdünger, da sie diesen zusammen mit Knöllchenbakterien aus der Bodenluft selbst gewinnen.
►Die attraktive Kugeldistel (Echinops spec.) ist eine je nach Art bis anderthalb Meter hohe, zweijährige Pflanze (siehe Artischocke) aus südlichen und östlichen Gefilden. Sie wird ständig von Hummeln, Wespen und Bienen belagert, weshalb Imker sie gerne um ihre Bienenstöcke herum anpflanzen.
►Lavendel (Lavandula spec.) ist eine Duftpflanze, die jeden Garten bereichert. Lavendel hat es gerne warm und trocken. Bestäuberinsekten zieht er an, Ameisen und Läuse dagegen vertreibt er, weshalb er sich gut eignet, um zusammen mit Rosen im Beet zu stehen.
►Malven (Malva spec.) und Stockrosen (Alcaea spec.) werden auch mit gefüllten Blüten angeboten, aber das hilft den Hummeln natürlich nicht. Also beim Kauf unbedingt auf ungefüllte Sorten achten. Die Farbpracht bleibt ungeschmälert.
►Der Natternkopf (Echium vulgare) ist eine heimische Wildstaude und gedeiht auf trocken-warmen Böden. Neben Hummeln und Schmetterlingen lockt der Langblüher (etwa von Mai bis August) auch unzählige Wildbienenarten an.
►Der Sommerflieder (Buddleia davidii) firmiert verbreitet unter der Bezeichnung Schmetterlingsflieder, was ein deutlicher Hinweis auf seine Beliebtheit bei Insekten ist. Den Strauch mit seinen leicht überhängenden Zweigen gibt es in violett und weiß. Wie man es auch von Flieder kennt, sorgt ein spätherbstlicher Rückschnitt für vermehrtes Blühen im Folgejahr.
►Die diversen Sonnenhut-Arten (Rudbeckia und Echinacaea) bilden dichte Stauden, aus denen je nach Sorte Blütenstängel von einem halben bis zwei Metern Höhe sprießen. Sonnenhüte sind klassische Bauerngartenpflanzen.
►Die heimische Taubnessel (Lamium spec.) gibt es in weiß oder in purpur. Im Halbschatten unter Büschen und Bäumen sollte sie auch im naturnahen Garten einen Platz finden. Teils blühen die Pflanzen bis in den Winter hinein.
Link zum NABU-Artikel: http://bit.ly/1J0S9Kg